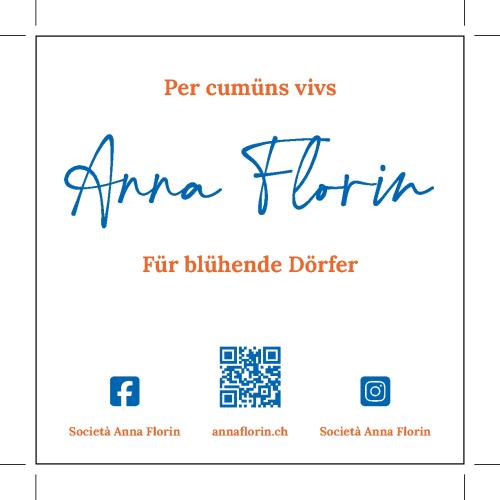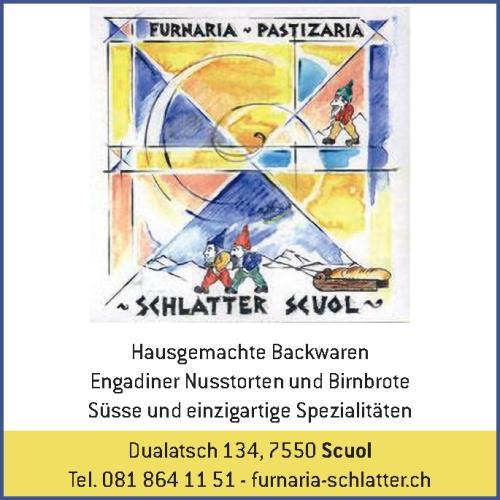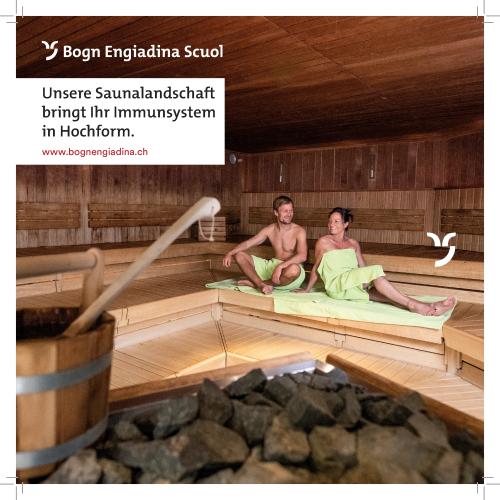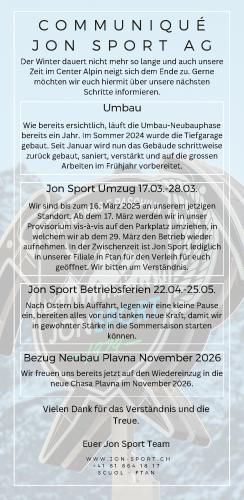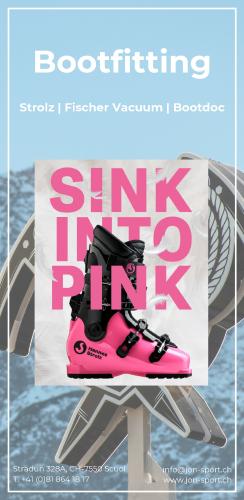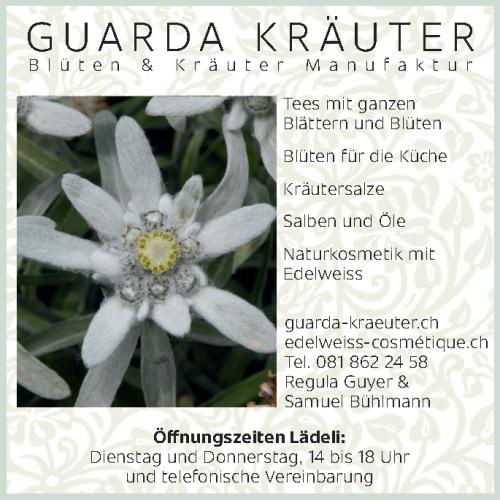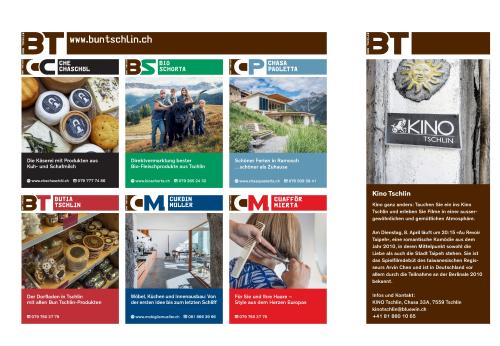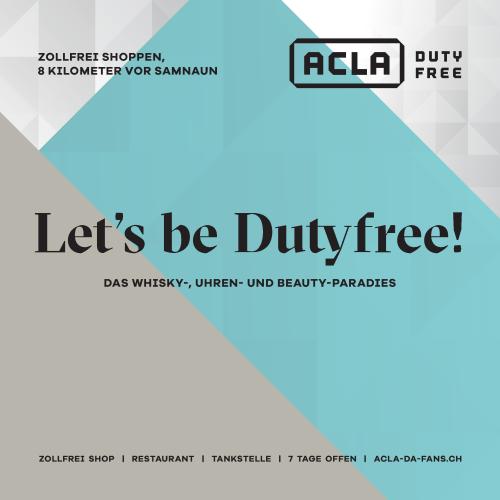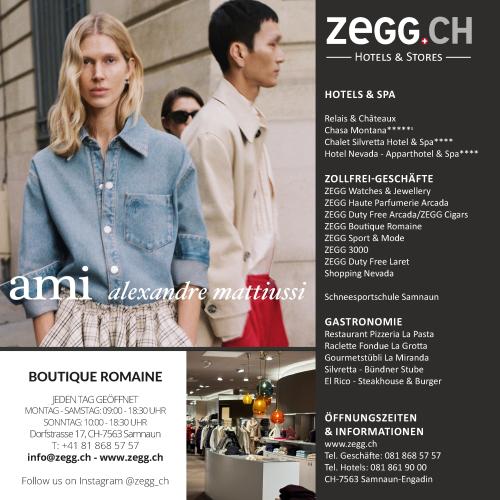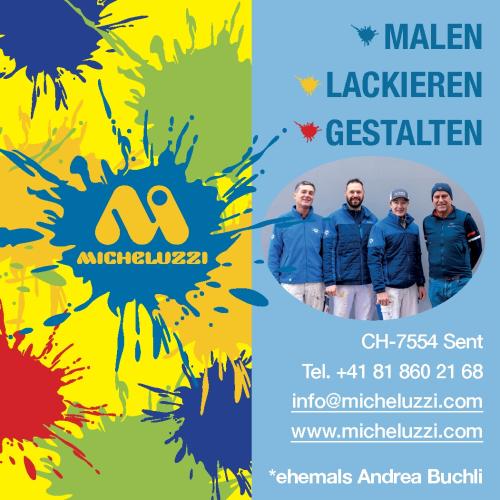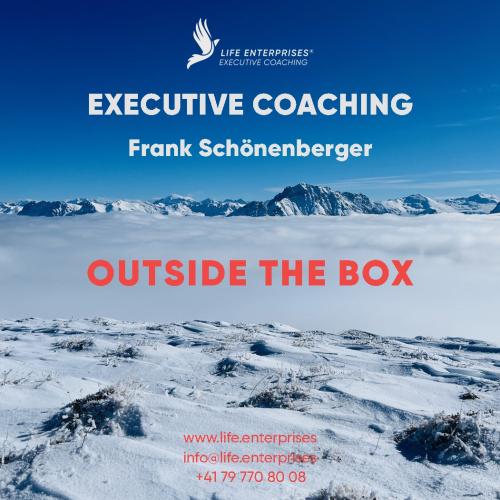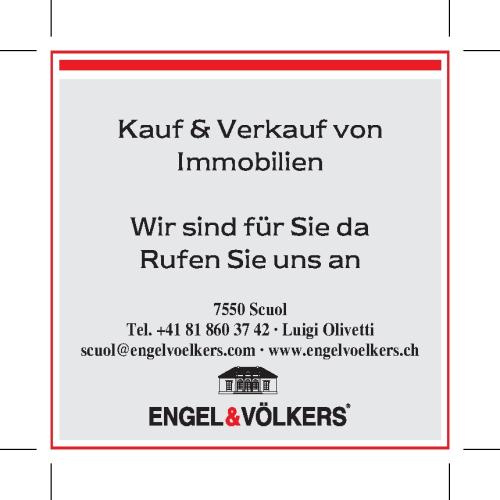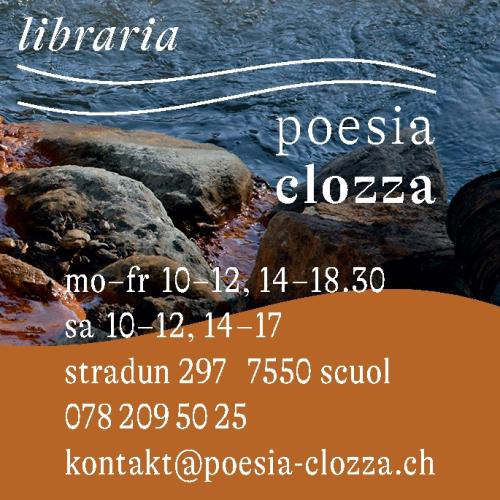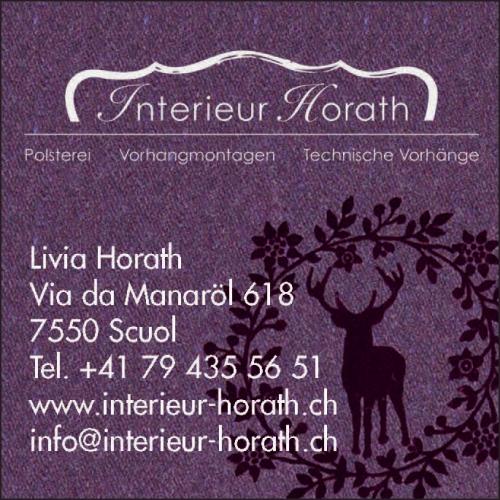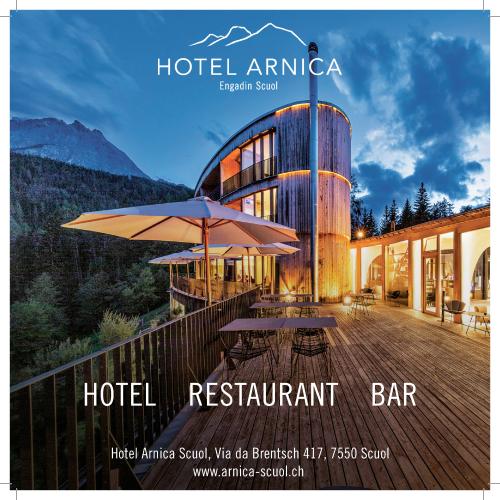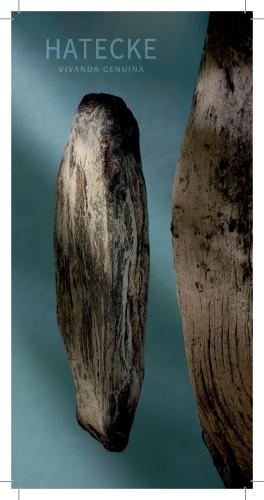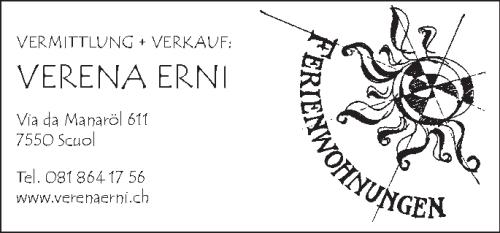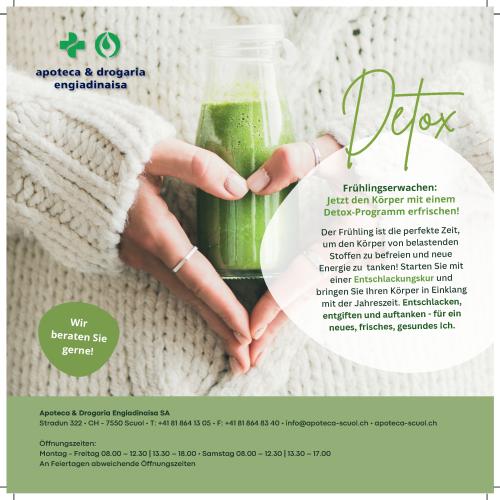Welches war Ihr Lieblingsmärchen?
Mir ist vor allem ein grauenvolles Märchen in Erinnerung. Das Engadiner Märchen L’homin cul chapè agüz (Das Männlein mit dem spitzen Hut). Aus heutiger Perspektive denke ich, dass es eine Geschichte über einen Missbrauch ist. Die Idee des verborgenen Palastes im Berg hat mir gefallen. Das Schöne am Märchen ist, dass es dank einer sehr mutigen und intelligenten Schwester ein gutes Ende nimmt. Doch der Schauder bleibt.
Braucht man überhaupt Märchen, wenn man auf einem Schloss aufwächst?
Klar, Märchen und Erzählungen sind essenziell. Indem man zuhört oder liest, reist man mit an Orte und macht fiktive Erfahrungen, die wichtig sind. Mein Vater erzählte viele Geschichten und heute, da er nicht mehr unter uns ist, lebt die Erinnerung an seine Erzählungen fort.
Wie ist es auf einem Schloss aufzuwachsen?
Ich bin mit dem Schloss gross geworden. Wir wohnten in einem Engadinerhaus am Fusse des Schlosses. Wir waren fast täglich oben. In den Schulferien war es klar, was unser Sommerjob war. Schlossführungen, Kassa, Putzarbeiten. Auch wir Kinder spürten die grosse Verantwortung, die auf den Schultern der Eltern lastete. Doch da gab es auch die heiteren Momente, Abendspaziergänge mit Verstecken spielen, Singen in der kleinen Schlosskapelle, Partys in den Jugendjahren.
Welches war Ihr Lieblingsort?
Als ich in Chur lebte und arbeitete, wollte ich am Wochenende in Tarasp nicht mehr bei den Eltern logieren. Ich bekam von der Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein die Erlaubnis, im ersten Wachthaus des Schlosses zu wohnen. Ein Häuschen, das gleich nach dem Haupttor auf einem westlichen Felsvorsprung steht. Es hat zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine gotische Stube. Da die Heizung nicht funktionierte, war es ziemlich kalt. Früher beherbergte die Prinzessin dort berühmte Gäste, Schriftsteller, Komponisten, Schauspielerinnen, die während einiger Wochen im Sommer dort logierten und arbeiteten. Dann stand es Jahrzehnte leer. Ich fuhr jeweils mit dem Motorrad ins Engadin und zum Schloss. (Kennen Sie das Märchen von der Prinzessin Pfiffigunde mit dem Motorrad?) Das war eine grossartige Zeit, und ich wusste schon damals, sie wird eines Tages vorbei sein. Meine Eltern, Freundinnen und Freunde freuten sich auch, dass ich im Schloss logierte. Der Ausblick in Richtung Flüelapass ist gewaltig. Wenn es stürmte, wackelte, knirschte und klopfte es überall. Einmal hörte ich auf dem Sofa im eiskalten Korridor unter Decken und dem Schlafsack ein Hörspiel über Hyänen. Draussen zog Nebel um die Gemäuer und es regnete. Ich war allein oben und fand das Gejaule der Hyänen im Hörspiel gruselig, aber auch passend zum Setting.
Gab es Geister?
Ja, ich habe mehrmals Geister gehört. Und es gibt sie noch immer.
Dann kam ein böser Ritter und vertrieb Euch vom Schloss, wo war da die gute Fee?
Böse Ritter gab es gewiss in der langen Geschichte des Schlosses. Ich sehe Not Vital eher als Prinzen, der das Schloss aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat. Es gibt wieder fliessendes kaltes und warmes Wasser im ganzen Schloss, eine funktionierende Heizung, Konzerte und Partys. Das Schloss ist voller Leben und zieht kunstinteressierte Besucher*innen aus der ganzen Welt an. Ich hoffe, es wird auch in Zukunft regelmässige Schlossführungen geben. Und jede Schülerin und jeder Schüler aus der Region sollte das Schloss Tarasp einmal besucht haben.
Haben Sie sich mittlerweile mit der Situation arrangiert?
Ja, an diesem Film zu arbeiten, war ein langer Ablösungsprozess. Diesen Übergang dokumentieren zu können, war sehr spannend und vieles war überraschend und unvorhersehbar. Der neue Schlossherr und Künstler Not Vital war gastfreundlich und interessiert. Einmal fragte ich Not, ob es nicht gut wäre, ein kleines Originalgemälde besser an der Wand zu fixieren, es habe ja in jeder Manteltasche Platz. Da schaute er mich lächelnd an und meinte, ich müsse mich nicht mehr verantwortlich fühlen für das Schloss. Wenn etwas gestohlen würde, müsse mich das nicht mehr beschäftigen. Das war ein toller Moment.
Nun haben Sie einen Film aus dieser Geschichte gemacht. Wie geht man an ein solches Projekt heran?
Als mein Vater mit mir vor über 20 Jahren telefonierte und mitteilte, dass die von Hessens das Schloss verkaufen wollen, war mir sofort klar, dass grosse Änderungen bevorstehen. Ich lebte damals seit Kurzem in Scuol, hatte zwei kleine Kinder und soeben die Zusatzausbildung als Videojournalistin hinter mir. Ich dachte mir, das Schloss sei ein tolles Übungsfeld und zog mit Kind und Kamera los. Die Nachricht des Verkaufs gab mir den Impuls, mit meinen Eltern zu filmen und vor allem Vaters Erinnerungen aufzuzeichnen. Ich begann ohne Druck zu dokumentieren, organisierte und drehte alles so, dass sich etwas daraus ergeben könnte. Erst im Jahr 2022 unterzeichnete ich einen Vertrag mit RTR, und es war klar, dass ich einen Dokumentarfilm machen werde. Nun habe ich zwei kurze Episoden für RTR, eine Dok für die Sternstunde Kunst und eine 61-minütige Festivalversion erarbeitet. Wunderbar war auch die Zusammenarbeit mit Oliver Conrad, einem sehr talentierten Trickfilmkünstler und Regisseur aus dem Oberengadin, der in Paris lebt.
Es besteht die Gefahr der zu starken Betroffenheit?
Natürlich. «Nur nichts überstürzen», das war meine Devise bei diesem Projekt. Zudem schafft der Blick durch die Kamera Distanz, emotionale und inhaltliche Distanz. Was sehe ich, was passiert da, was hat das mit der Gesellschaft, mit Geschichte zu tun, was mit mir? Die Regisseurin in mir half mir, als Teil der Schlossverwalterfamilie zu reflektieren, was da vor sich ging. Das Schloss ist die Hauptperson im Dokumentarfilm. Mein persönlicher Zugang zur Geschichte ist der Startpunkt. Nur ich kann diese Geschichte so erzählen. Mich interessierte, wie die Dinge sich ändern, wie Geschichte passiert. Dass dies auch schmerzvoll sein kann, soll nicht verschwiegen werden. Mir war wichtig, dass die Erzählung eine universelle Ebene entwickelt. Jetzt, da der Film fertig ist, staune ich, wie viel in 23 Jahren passieren kann. Über drei Generationen wurde das Schloss Tarasp von meiner Familie verwaltet. Ende 2016 ging dieses Kapitel zu Ende. So wurde der Dokumentarfilm «Nos Chastè» auch eine Geschichte menschlicher Entscheidungen und deren Auswirkungen, ein Beispiel für Loslassen und Neuanfang.
Was fasziniert Sie an diesem Metier?
Erzählte Geschichte zu fixieren, das ist wertvoll. Das wurde mir schon früh bewusst. Bei meinem Dokumentarfilm «I Giacometti» zum Beispiel freue ich mich, mit letzten Zeitzeugen, die die Giacomettis noch persönlich gekannt hatten, gesprochen zu haben. Auch wenn nur wenige Teile der Interviews für den Film genutzt wurden, das Rohmaterial bleibt bestehen. In der Zwischenzeit sind vier dieser Zeitzeug*innen verstorben. Beim «Nos Chastè» ist es ganz ähnlich, nur haben meine Geschwister und ich Dinge erfahren, die uns auch persönlich angehen, die wir ansonsten wohl nie erfahren hätten. Eine Frau berichtete mir, nachdem sie den Film gesehen hatte, er habe ihr schmerzlich vor Augen geführt, dass sie es verpasst habe mit ihrem Vater über sein Leben zu sprechen.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich arbeitete als Journalistin bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Vom Radio wechselte ich zum Fernsehen und da kam der Tag, wo der damalige TV-Chef – ein Ethnologe - mir vorgeschlagen hatte, nach Spanien zu reisen und einen Dokumentarfilm über einen rätoromanischen Orgelbauer zu machen, der dort mit seiner Frau verstaubte Orgeln renovierte. Ich war sofort Feuer und Flamme für diese Idee. Nun stellen Sie sich vor, Sie wollen einer Fernsehstation einen Film über nicht funktionierende Orgeln anbieten – die Leute würden wohl denken, die spinnt. Doch RTR macht immer wieder ganz besondere Geschichten. Meine Freude am Thema hatte auch mit dem Schloss Tarasp zu tun. Da gibt es nämlich eine schöne pneumatische Orgel. Als ich klein war, funktionierte sie nicht und wir spielten in den Räumen, wo die Pfeifen sind. Ich kannte also Orgeln bis ins Detail, eine Orgel war ein mir bekanntes Universum. Dieser erste Dokumentarfilm war für mich ein Schlüsselmoment. Von da an habe ich mich immer mehr auf den Dokumentarfilm fokussiert und in der Zwischenzeit über 30 kurze und einige lange Dokumentarfilme geschaffen. Die Themen suche ich meistens in meinem Umfeld.
Welches ist der schwierigste Moment im ganzen Prozess?
Bei jedem Projekt gibt es Schwierigkeiten, das gehört dazu. Die Schwierigkeiten sind immer wieder andere. Seit ich mich selbständig gemacht habe und die Filme auch finanzieren muss, ist die Finanzierung ein ständiges Thema. In einer wirtschaftlich schwachen Randregion zu leben und das teure Medium Film zu machen, ist nicht ganz einfach.
Wann sieht man den Film zum ersten Mal und wie ist das?
Ich feierte im Januar zum zehnten Mal mit einem Dokumentarfilm an den Solothurner Filmtagen die Premiere. Ich liebe es, mich im Kinosaal in einem Sessel sinken zu lassen und dem Atem des Filmes zu horchen. Wo reagieren die Leute, werden die feinen Pointen verstanden usw.
Wer sind Ihre kritischen Geister respektive Begleitende auf diesem Weg?
Ein Film ist immer eine Arbeit von vielen Menschen. Ich arbeite seit Jahren mit dem gleichen Editor, Cutter in Zürich, mit meiner Produktionsassistentin und dann je nach Projekt mit weiteren wunderbaren Fachpersonen. Koproduziere ich mit RTR und dem SRF, gibt es gute Gespräche mit den Produzent*innen. Mein Mann und meine Kinder haben mir auch immer sehr ehrliche Rückmeldungen gegeben. Ich kann gut allein arbeiten und ich liebe es, mit tollen Menschen für ein Projekt gemeinsam unterwegs zu sein.
Wie nervös ist man vor der Premiere?
Ich dachte, es werde besser mit der Erfahrung und mit dem Alter. Es ist aber immer wieder sehr aufregend und ich bin jeweils sehr nervös. Ich habe auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die im Film vorkommen.
Was ist schlimmer? Die Premiere in Solothurn oder den Film im Engadin zu zeigen?
Den «I Giacometti» im Bergell zu zeigen, das war schon eine Anspannung der besonderen Art…doch überall gab es Expert*innen in den Kinosälen. Bei «Nos Chastè» habe ich festgestellt, dass ganz viele Menschen eine Beziehung zum Schloss haben. Es ist eben nicht nur im Engadin, sondern schweizweit «Nos Chastè» – «Unser Schloss».
Was kommt als Nächstes?
Ich arbeite zurzeit an einem kurzen Fernsehfilm über die Kunstbauten von Bondo, Klimawandel und Ingenieurbaukunst. In Bondo im Bergell wird auf einer der grössten Baustellen der Schweiz gearbeitet. 2017 hat der Bergsturz in Bondo enorme Schäden angerichtet und acht Menschenleben gefordert. Die Stein- und Schlammlawine ergoss sich zwischen den zwei Dorfteilen von Bondo, zerstörte Landschaft und Infrastruktur in Bondo und Spino. Anhand der Wiederherstellung der Landschaft, der Infrastruktur und der neuen Schutzbauten erfahren wir die Sichtweise der Ingenieure, der Landschaftsarchitekt*innen, der Bevölkerung und der Gemeindebehörde. Durch die Betrachtung der konkreten Bauwerke erkennen wir die Dimension der Katastrophe und mögliche Szenarien der Zukunft. Kann sich der Mensch vor unvorhersehbaren Naturkatastrophen schützen? Eine Frage, die viele Menschen in Bergregionen beschäftigt.
Auch arbeite ich an der Entwicklung eines Dokumentarfilmes über den Künstler Augusto Giacometti. Ich freue mich sehr, mit dem Projekt in die Produktionsphase zu kommen. ((Falls jemand von einer Stiftung das Projekt unterstützen möchte….kontaktieren Sie mich bitte www.pisocpictures.com ))
Susanna Fanzun begann als Radiojournalistin bei RTR. Als sie zum Fernsehen wechselte bekam sie eines Tages den Auftrag einen Dokumentarfilm über einen rätoromanischen Orgelbauer zu machen, der in Spanien Orgeln renovierte. Dies war der Startschuss zu ihrer Karriere als Dokumentarfilmerin, inzwischen hat sie über 30 kürzere oder länger Dokumentarfilme realisiert. Darunter auch «I Giacometti», über die Künstlerfamilie aus dem Bergell.
«Nos Chastè» läuft wie folgt im Unterengadin
15.3.2025, 20.15 Uhr, Fundaziun Nairs
nairs.ch/de/veranstaltung/filmculinarica-nos-chaste-von-susanna-fanzun/
16.3.2025, 10.15 Uhr/12.15 Uhr/15.15 Uhr, Cinema Staziun Lavin
Informationen zu allen Spielzeiten auf pisocpictures.com